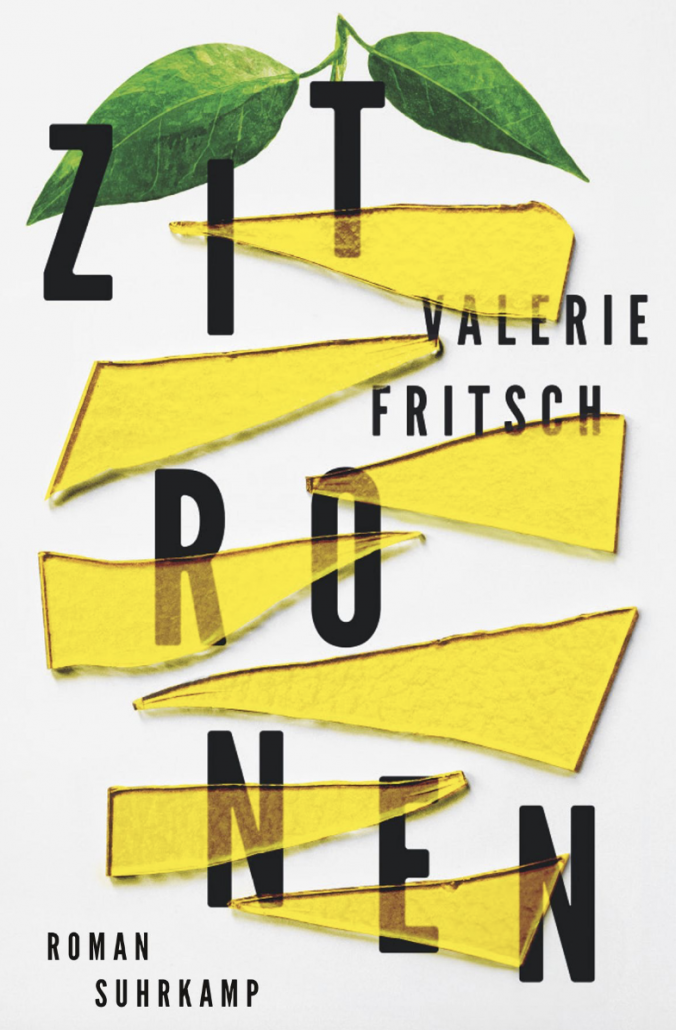Valerie Fritsch spielt in einer ganz anderen Liga als zahlreiche gleichaltrige Autoren und Autorinnen im deutschsprachigen Raum – um an dieser Stelle auch mal eine Redensart aus dem Sport anzubringen. Und auch der 2016 im Suhrkamp Verlag erschienene Roman „Winters Garten“ stellt dies unter Beweis.
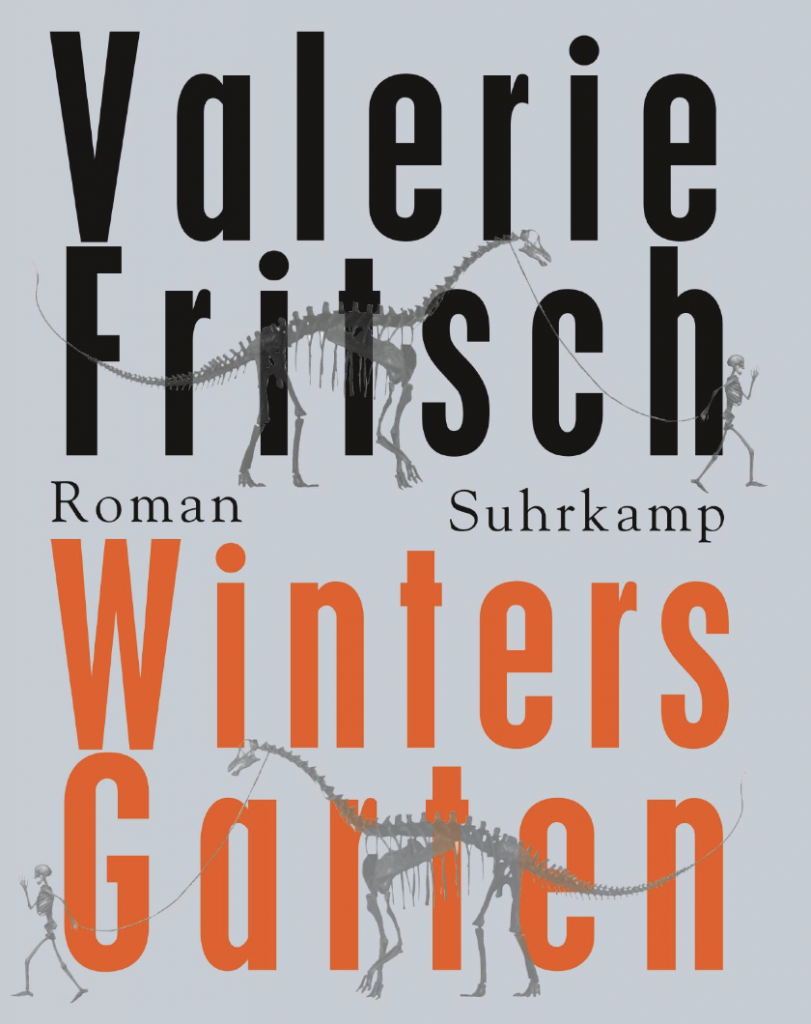
Wer den aktuellen Roman „Zitronen“ von Valerie Fritsch gelesen hat, der möchte vielleicht mehr über die Autorin erfahren beziehungsweise mehr von ihr lesen und wird bei einer Recherche zu ihrem Werk unweigerlich auf „Winters Garten“ und „Herzklappen von Johnson und Johnson“ stoßen – so ist es auch mir ergangen.
Auch in „Winters Garten“ bietet Valerie Fritsch eine sprach- und bildgewaltige Prosa und phänomenale Sätze und Einsichten, die den Leser nachdenklich machen, zum Beispiel: „Die Jungen suchten mit der Dringlichkeit des Anbeginns die Wege, die sie gehen wollten, und die Alten gingen in Demut die Wege zu Ende, die sie einst gewählt hatten.“
Es ist eine apokalyptische Welt in die der Protagonist Anton Winter hineingeboren wird. Er verbringt seine Kindheit und Jugend mit seiner Familie in einem paradiesischen Garten, geht als erwachsener Mann und Vogelzüchter in die Stadt, die bereits im Verfall befindlich ist, lernt dort seine Liebe Frederike kennen und kehrt mit dieser anschließend zurück in den Garten, der mittlerweile ganz verlassen und verkommen ist, zurück. Der Roman thematisiert eine Gegenwart, die keinem etwas zu bieten hat, eine Liebe, die Halt aber kaum Hoffnung gibt. Vieles lässt sich als Parabel auf das moderne Leben und die Sehnsüchte der Menschen lesen, aber mir war bei der Lektüre dieses Buches der Inhalt weniger wichtig als die Sprache und die einzelnen Bilder:
„Für Anton Winter war die Kindheit vollgestopft mit hohen Gräsern und Teerosen und grünen Äpfeln in den Bäumen, die man den ganzen Sommer über so begehrlich ansah, dass sie irgendwann schüchtern erröteten.“
Inhaltlich läßt sich vielleicht sogar kritisieren, dass hier einige Lücken existieren, wenn zum Beispiel von einem Krieg die Rede ist, man aber niemals erfährt, wer hier warum kämpft und ob dieser Krieg noch andauert oder schon lange vorbei ist. Außerdem lesen wir von Massenselbstmorden, erfahren aber niemals die Hintergründe hierzu. Ebenso wird die um sich greifende Hoffnungslosigkeit niemals erläutert oder begründet. Raum und Zeit sind eine vielleicht schon postapokalyptische Welt, die der Leser so einfach hinnehmen muss:
„Den einsamsten aller Planeten hat mein Großvater die Erde genannt, weil hier jeder für sich allein kämpft und jeder für etwas stirbt, für das man gerne leben würde.“