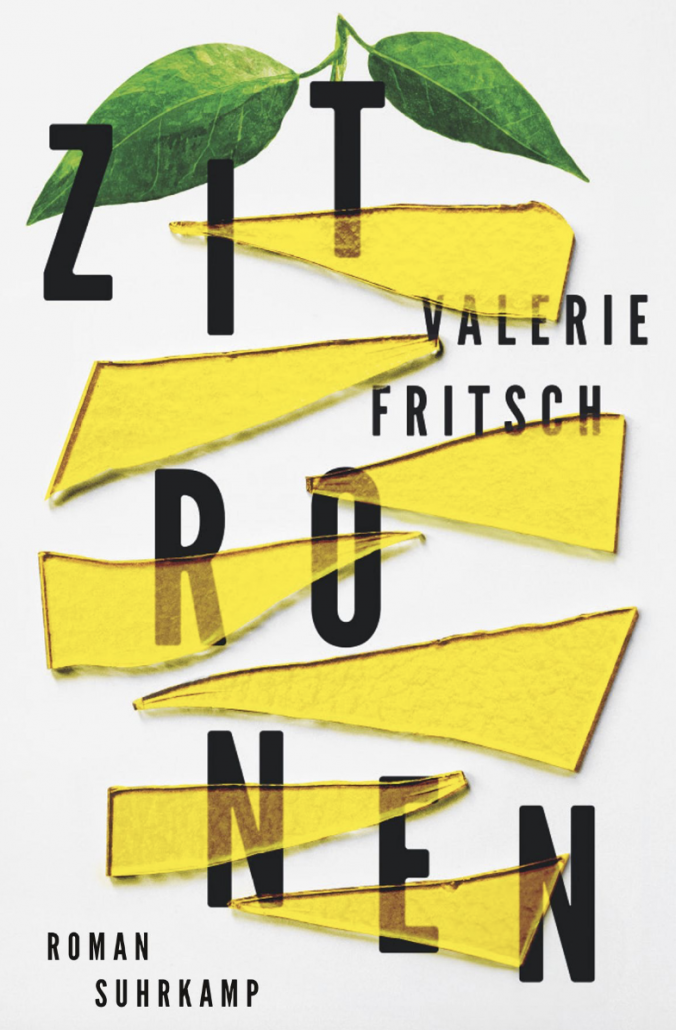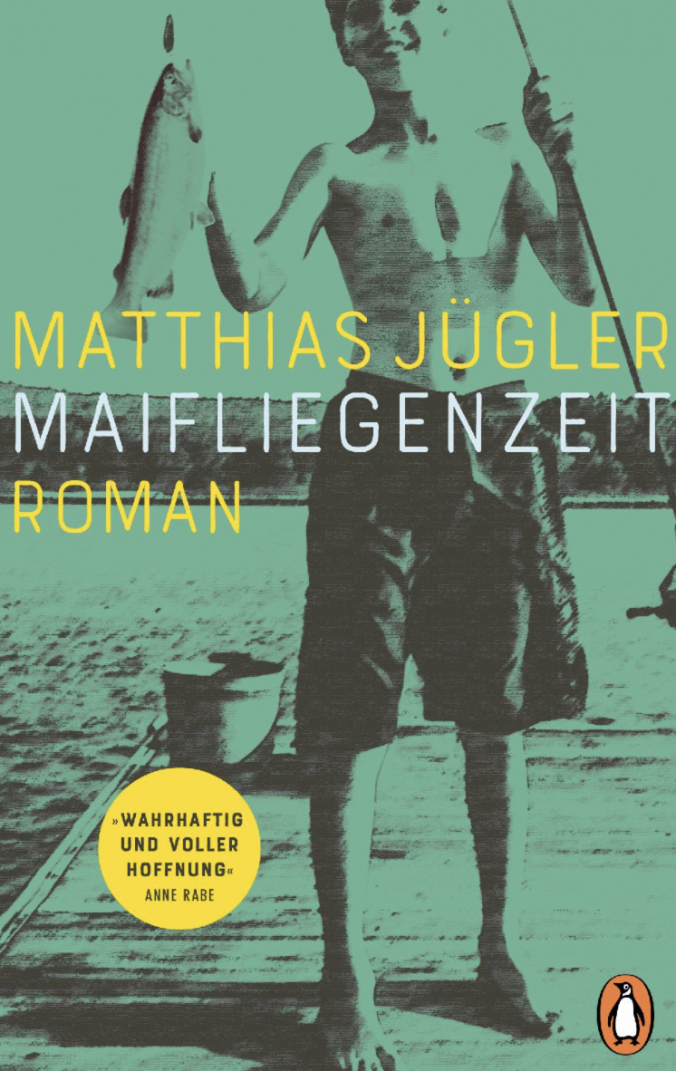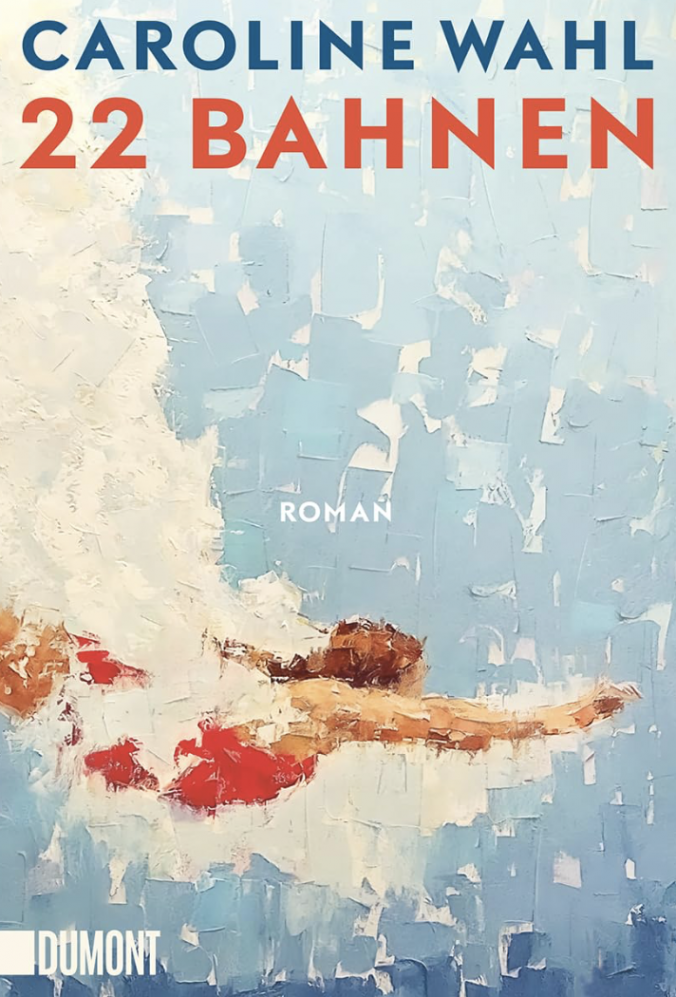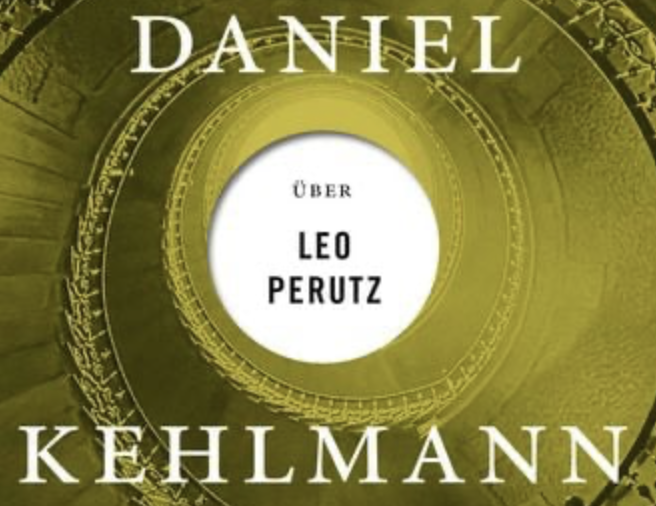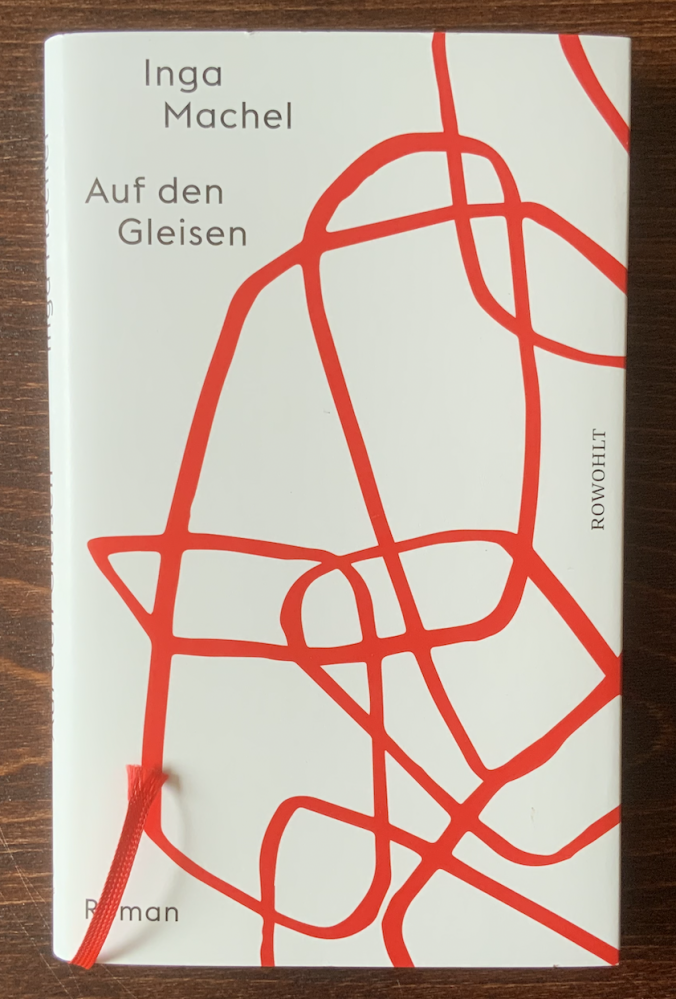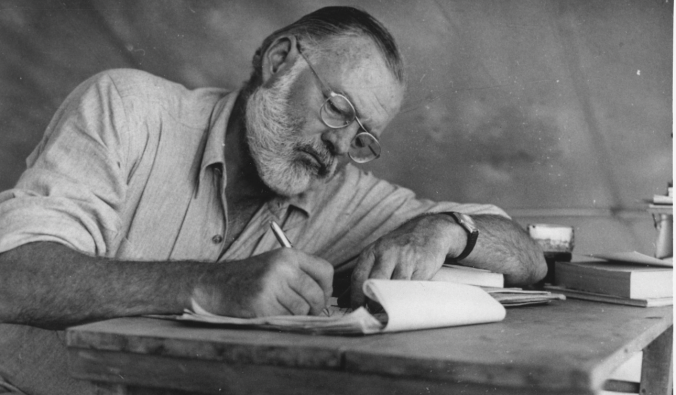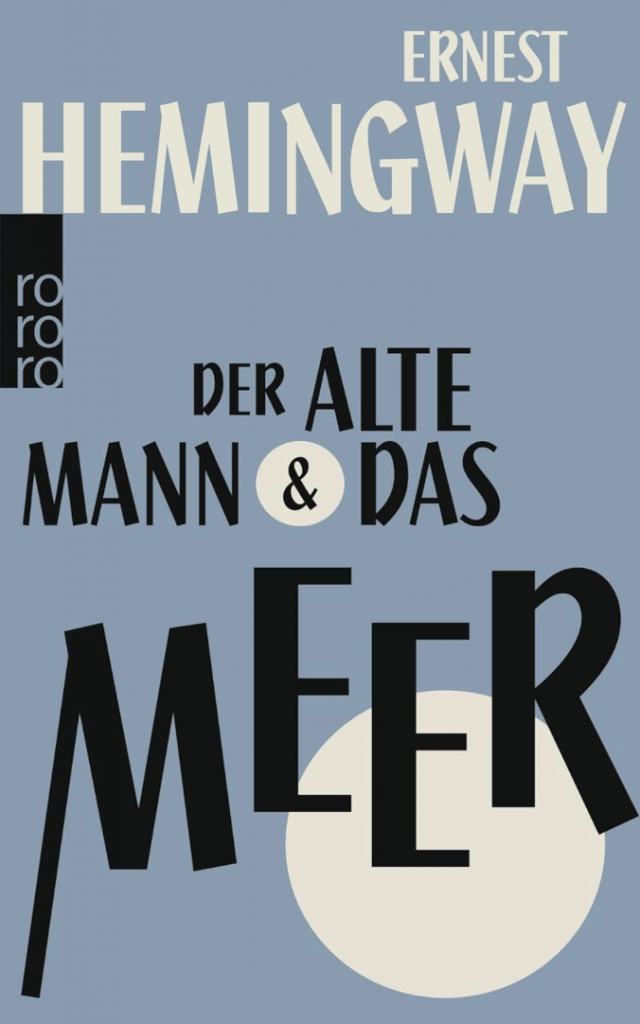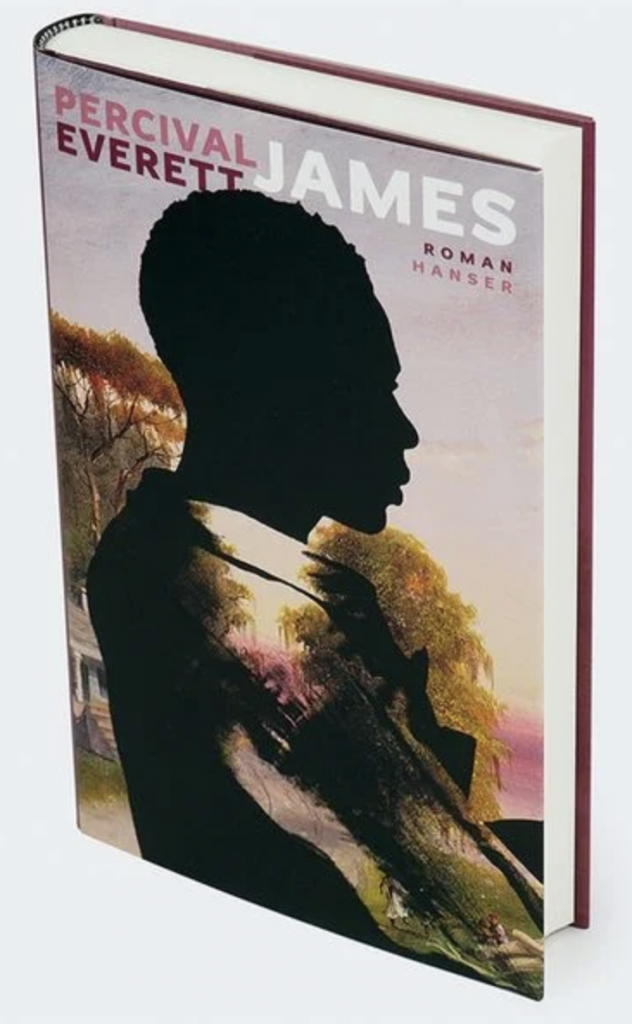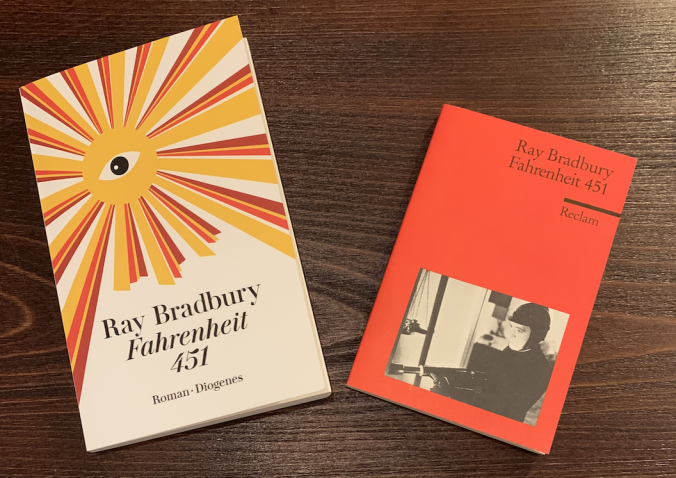Valerie Frisch, österreichische Schriftstellerin und Photografin, Jahrgang 1989, ist mit ihrem im Februar 2024 erschienen Roman „Zitronen“ zu Recht für den österreichischen Buchpreis nominiert worden.
Auf etwa 180 Seiten erzählt sie sprach- und bildgewaltig das Schicksal des jungen August Drach, der zuerst von seinem Vater geschlagen wird und als dieser plötzlich verschwindet, offenbart sich die wahre Natur seiner Mutter. Sie mischt ihm Medikamente unters Essen, um ihn krank zu machen und anschließend durch seine Pflege Aufmerksamkeit und Bewunderung zu erhalten – ein Verhalten bekannt als Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Hier liegen Gewalt und Zärtlichkeit stets so dicht beieinander, das die Lektüre manchmal nur schwer auszuhalten ist – aber es lohnt sich dran zu bleiben.
Umrahmt wird das triste Leben des August Drach von zahlreichen morbiden Auflistungen: da sind die Einzelschicksale im Dorf und das Verschwinden zahlreicher Menschen, inklusive kleiner Kinder, in der Pflege gequälte Senioren, brutal zugerichtete Leichen im Leichenschauhaus, Mörder und ihre Verbrechen in der Nachbarschaft und vieles mehr. Inhaltlich ist der Roman nur schwer zu verdauen, sprachlich jedoch ein grandioses, selten vorkommendes literarisches Großereignis.
Ein paar willkürliche Zitate aus den ersten zwanzig Seiten:
„August Drach schoss stets als Letzter, schnell und ohne mit der Wimper zu zucken, als wüsste er schon, dass einem das Leben das Abwarten verzieh, aber nie das Zögern.“
„Sie lebte ein anstrengendes Leben unter dem löchrigen Deckmantel eines unangestrengten Tagesablauf.“
„Sie liebte alles, was schön war, und fand manches schön, was anderen bloß wirr vorkam, weil es über das Paradies keine Einigkeit gab.“
„Der Vater rührte keinen Finger, aber erhob oft die Hand.“
„[…] er sagte nichts, nicht guten Morgen und nicht guten Abend, nicht bitte und nicht danke, das Haus vibrierte unter seiner Stummheit, das Schweigen wurde zum Faden, an dem hängend er sich in sich selbst verirrte und an dem er später zurückgehen musste, um aus dem Labyrinth seines Inneren herauszufinden.“
Sie spielt mit Gegensätzen, zeichnet ohne viele Adjektive überdeutliche Bilder, formuliert aphoristisch und man möchte sich hunderte ihrer Sätze merken, um diese bei nächster Gelegenheit zu zitieren.
Ein Mensch, der nie das Urvertrauen seiner Eltern kennengelernt hat, kann kein gelungenes Leben, keine gesunde Beziehung führen und so wird August Drach im zweiten Teil des Romans erwartungsgemäß in seiner ersten und einzigen Liebesbeziehung scheitern und der Roman auf ein krachendes Ende zusteuern. Mehr sei hier nicht verraten, nur die Mahnung: unbedingt lesen! Wer Valerie Fritsch nicht liest, übersieht eine wichtige deutschsprachige Gegenwartsautorin.