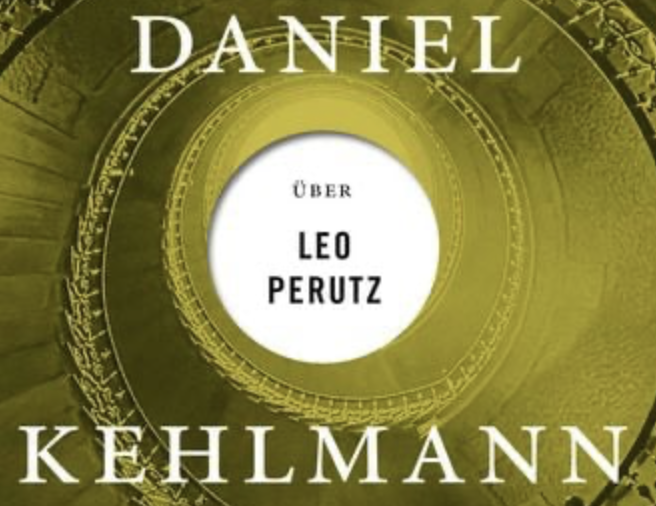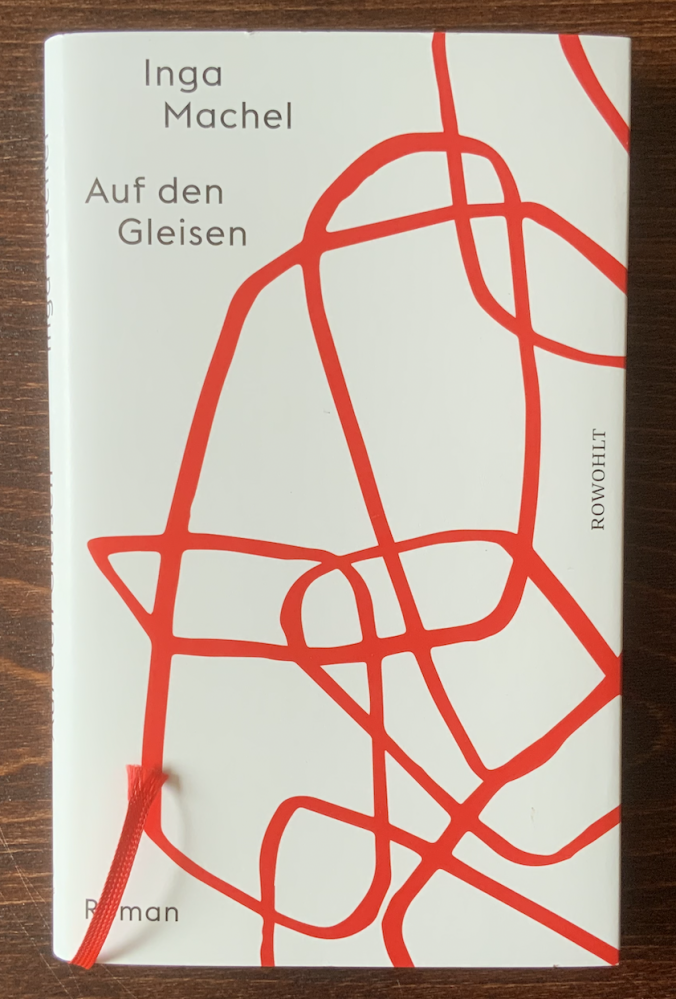Zu teuer, zu kurz, zu überhöht, nicht zeitgemäß – und doch zu empfehlen.
In der Reihe „Bücher meines Lebens“ aus dem Verlag Kiepenheuer und Witsch, herausgegeben von Volker Weidermann, ist im September 2024 der kleine Titel „Über Leo Perutz“ von Daniel Kehlmann erschienen.
Nehmen wir mal das Vorwort, den Anhang und die Werbung außen vor, dann bezahlen wir Leser für neunzig Seiten ganze zwanzig Euro – das finde ich zu teuer, zu kurz.
Den neunzig Seiten angemessen versuche ich mich kurz zu fassen:
Der Klappentext läßt uns wissen, dass hier „Kehlmann über den unbekanntesten Grossmeister der deutschen Literatur: Leo Perutz“ schreibe. Wer sich mit Titeln auskennt weiß, etwas höheres kann es nicht geben und das erscheint mir zu überhöht, da Kehlmann es zum einen nicht begründen kann und ich mich frage, welchen Titel dann ein Thomas Mann, ein Goethe oder ein Kafka bekommen soll?
„Leo Perutz‘ Werk ist zur Gänze lieferbar, die Literaturwissenschaft beschäftigt sich mit ihm, es hat Ausstellungen über ihn gegeben, es liegt eine profund recherchierte Biografie vor. Und dennoch ist Perutz, gemessen an seinem Rang, kaum bekannt“ schreibt Kehlmann zusammenfassend in seiner Einleitung und liefert damit ein vollkommen falsches Bild: nur eine kleine Teilmenge seiner Romane ist lieferbar, wichtige Novellensammlungen wie „Herr, erbarme Dich meiner“ nur antiquarisch erhältlich, die Theaterstücke gar nicht lieferbar und kaum ein Buchhändler (vermutlich kann ich mich trauen zu sagen: kein einziger) hat Titel von Leo Perutz vorrätig in seinem Sortiment – vielleicht gibt es bundesweit ein paar Ausnahmen die Perutz bekanntesten Roman „Nachts unter der steinernen Brücke“ präsentieren können.
Was Kehlmann hier auflistet sind Ausnahmeerscheinungen und keine Wiedergaben aus dem täglichen Feuilleton – in Wahrheit ist Leo Perutz einer der vielen vergessenen deutschsprachigen Autoren, die im Prag und Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Welt der Caféhäusern ihren ersten Ruhm genossen, heute aber nur im Antiquariat zu finden sind.
Hier würde ich Herrn Kehlmann auch gerne persönlich darauf aufmerksam machen wollen, dass nur weil ein Internetriese einen Titel noch auf Lager hat, heisst dies nicht, dass es auch tatsächlich noch im stationären Buchhandel erhältlich oder lieferbar ist.
Und dennoch ist dieses kleine Büchlein empfehlenswert, denn Daniel Kehlmann schreibt mit einer großen Liebe und Begeisterung über das Werk von Leo Perutz und kämpft so gegen das Vergessen dieser lesenswerten Autors. Kehlmann offenbart sich als glühender Verehrer von Leo Perutz und wandert in kleinen Kapiteln durch dessen Werk. Hierbei legt Kehlmann den Fokus auf den Inhalt der Geschichten und ihrem Plot – das, so stellt Kehlmann immer wieder klar, ist das bedeutendste an Perutz Werk.
Dem schließe ich mich an und ich kann Perutz „Nachts unter der steinernen Brücke“ nur jedem ans Herz legen. Eine großartige Novellensammlung, die sich am Ende zu einem einzigartigen Roman zusammenfügt, jede Novelle mit einem grandiosen, meist sehr überraschenden Plot.
Aber… nicht zeitgemäß ist die Sprache Perutz´. Eine schöne, elegante, langsame und warme Sprache, aber der heutige Leser – ob zwanzig oder vierzig Jahre alt – kann damit schon Probleme bekommen und muss sich zum Plot erst durchkämpfen:
„Im Herbst des Jahres 1589, als in der Prager Judenstadt das große Kindersterben wütete, gingen zwei armselige Spaßmacher, ergraute Männer, die davon ihr Leben fristeten, daß sie bei den Hochzeiten die Gäste belustigten, durch die Belelesgasse, die vom Nicolasplatz zum Judenfriedhof führte.“
So beginnt die erste Novelle „Die Pest in der Judenstadt“ in „Nachts unter der steinernen Brücke“ und mit diesen 250 Zeichen allein schon im ersten Satz sind zahlreiche Leser heute überfordert. Ich wünsche Perutz viele Leser und vielleicht kann Kehlmann ja mit seiner Hommage an Leo Perutz die Neugier und den Lesehunger wecken – ich wünsche es beiden.