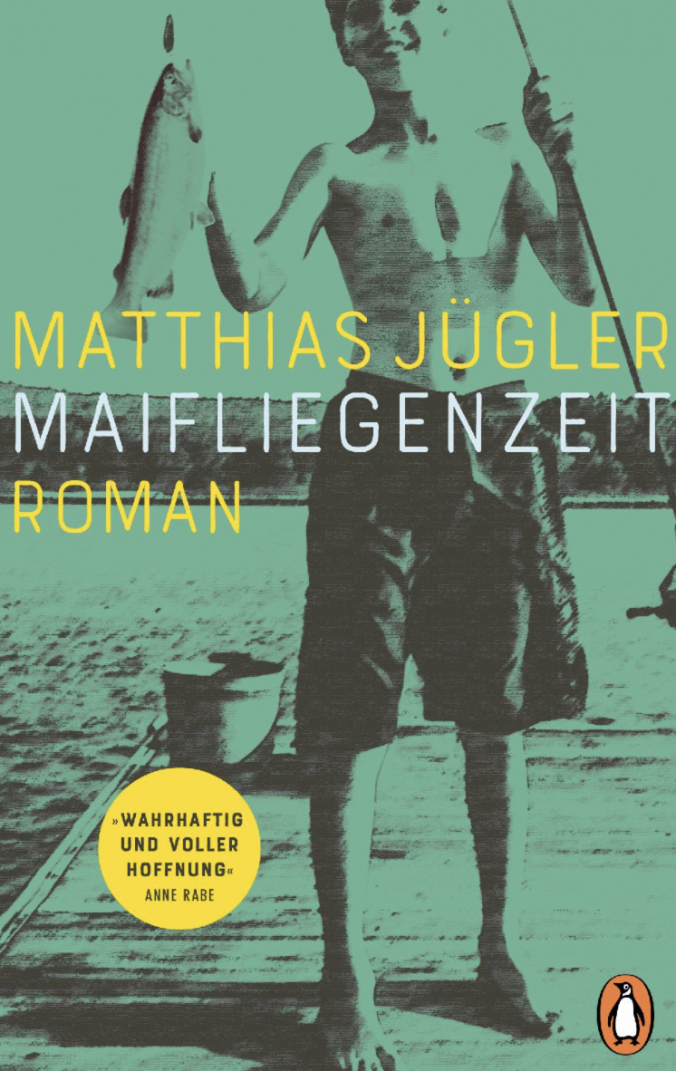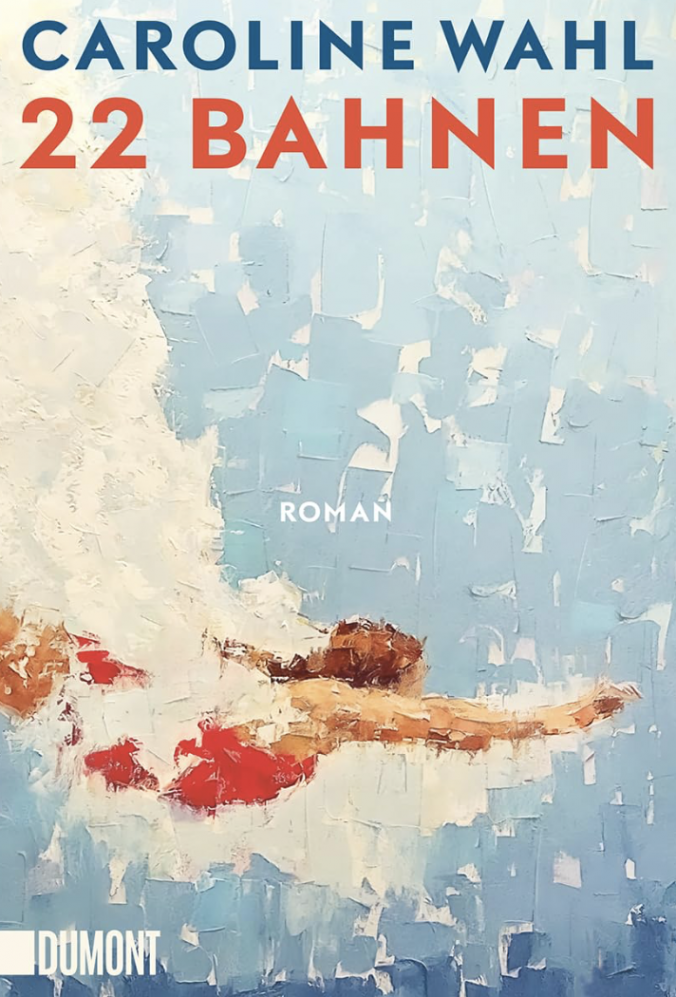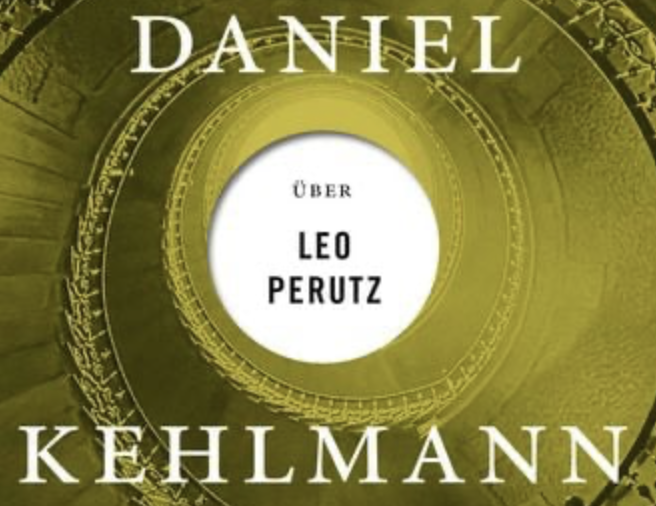„Aber nur, weil sich etwas dem Blick so konsequent entzieht, heißt das nicht, dass es nicht existiert.“
Mit diesem Satz könnte man den 2024 im Penguin Book Verlag erschienen Roman des 1984 in Halle an der Saale geborenen Matthias Jügler durchaus zusammenfassen und damit wäre das immer wiederkehrende Hauptmotiv der Wahrheitssuche auch bestens beschrieben. Aber zuerst etwas ganz anderes vorweg: wer diesen Roman lesen und genießen möchte, dem sei er auf jeden Fall ans Herz gelegt, aber dringend nur unter folgender Bedingung zu konsumieren: keine Recherche vorab zu diesem Buch im Netz und alle Klappentexte und Beipackzettel unbedingt ignorieren. Einfach nur den Roman als Roman genießen.
Die jungen Eltern Hans und Katrin freuen sich auf ihr erstes Kind, erleben jedoch nach der Geburt den Albtraum, dass ihr Kind für tot erklärt wird, ohne dass sie es nochmals zu sehen bekommen. Katrin hat von Anfang an ein ungutes Gefühl und glaubt, dass ihr Sohn lebt, Hans kann nichts tun und möchte das Katrin das Unglück akzeptiert. Darüber zerbricht ihre Beziehung und in beider Leben bleiben Zweifel und Misstrauen, immer wieder Suchen und Hoffen und steht der Wunsch endlich die Wahrheit zu erfahren. Dies ist – ohne weiteres verraten zu wollen – eine Ebene des Roman, die vom traumatischen Verlust, von folgenschweren Zweifeln, einem Neubeginn und einer hoffnungsvoller Suche erzählt.
Daneben gibt es noch die Ebene der Bilder aus der Angelwelt. Hans ist Angler, letztlich angetrieben durch das Hobby seiner verstorbenen Vaters, der immer wundersame Geschichten von Fischen erzählt, die Hans, seine Geschwister und seine Mutter ihrem Vater niemals geglaubt haben, weil der Vater selten etwas vom Angeln mit nach Hause brachte und seine sonderbaren Fische niemals zu sehen waren. Dies – und der Blick auf die verborgene Wahrheit ändert sich – als Hans selber zu angeln beginnt und sich eine wundersame Geschichte seines Vaters nach der anderen als Wahr herausstellt.
Ein kurzweiliger, wunderbar erzählter Roman, der zudem spannend ist, so dass er mit seinen etwa 150 Seiten auch schnell durchgelesen ist.
Der Autor wurde und wird für diesen Roman und seine Geschichte heftig kritisiert, hieran will ich mich aber nicht beteiligen, denn die Frage ob die Fiktion eine reale Basis hat, ist nicht zwingend relevant für den Lesegenuss.